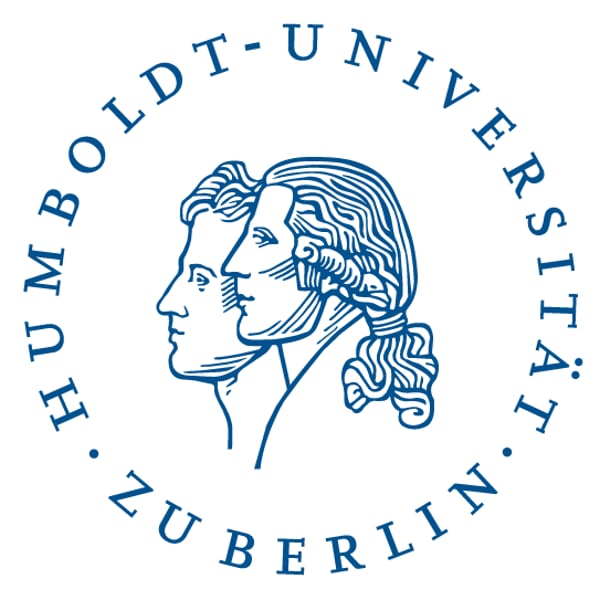Die Veranstaltungen sind auf dieser Seite nach den Modulen der Bachelor- und Masterstudienordnungen von 2019 geordnet. Auch die Verlinkungen zu den Moodle-Kursen können Sie bei der jeweiligen Veranstaltung finden – sofern vorhanden.
Zuerst finden sie die Informationen zum Bachelor Nebenfach, weiter unten jene zum Masterstudiengang. Hinweise zu den Modulen und dem Studium allgemein finden sie hier.
Bachelor Studiengang
Modul I - Einführung in die Medienwissenschaft (10 LP)
Mechanische, elektrische und elektronische Grundlagen der Medien (Einführung Medientheorie)
Veranstaltungsnummer: 53515 /
Leistungspunkte: 3 /
Lehrende/r:
Ingolf Haedicke
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Seminar bietet Studierenden der Medienwissenschaft die Möglichkeit, die technischen Grundlagen der Medien kennenzulernen und zu begreifen. In diesem Zusammenhang entsteht nebenbei ein Überblick zu verschiedenen medienwissenschaftlichen Bereichen, der ein grundlegendes technisches Verständnis schafft, das für das weitere Studium nützlich sein wird. Hierzu wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern keinerlei Fachwissen vorausgesetzt.
Auf der Agenda stehen:
• akustische und elektrische Schwingungen, elektrische Wandler, Speicherung (mechanisch, magnetisch und optisch)
• Funktionsweise von Musikinstrumenten (inkl. Klangsynthese)
• Messtechniken
• Magnetismus, Elektromagnetismus (Oersted, Faraday)
• chemische und elektrodynamische Spannungsquellen
• Bausteine der Elektronik (Spule, Kondensator, Röhre, Transistor, Flip-Flop, ICs)
• Entwicklung der drahtlosen Nachrichtenübermittlung
• Prinzipien der elektronischen Bildaufnahme und Verarbeitung (photoelektrischer Effekt, Bildsensoren etc.)
• Stationen der Ton- und Bildübertragung (Rundfunk, Fernsehen)
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul II - Medientheorien (10 LP)
Kanonische Texte zur Theorie und Archäologie technischer Medien
Veranstaltungsnummer: 53507
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Grundlage dieses Seminars sind Texte, die sich aus Sicht einer techniknahen Medienwissenschaft als maßgeblich für die Theorie von Medien (auch avant la lettre) herauskristallisiert haben. Der Fokus liegt auf Analysen, die zwar in erster Linie geisteswissenschaftlich-diskursiv verfaßt sind, jedoch in der konkreten Kenntnis technologischer Verhältnisse gründen. Zielführend in Lektüre und Diskussion ist die gemeinsame Erarbeitung und kritische Aneignung eines Textkorpus, der das spezifische Orientierungsprofil der Medien(geschichts)theorie an der Humboldt-Universität erkennen lässt. Selbstverständlich lassen sich Medientechniken nicht auf historische Diskurse reduzieren; ihre Anamnese wird sich daher nicht auf Texte allein beschränken, sondern entlockt dem technischen Archiv - sowie konkret dem Medienarchäologischen Fundus am hiesigen Institut - ebenso Zeichnungen, Diagramme, Formeln und Maschinen.
Claus Pias / Joseph Vogl / Lorenz Engell / Oliver Fahle / Britta Neitzel (Hg.), Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Texte von Brecht bis Baudrillard, Stuttgart (DVA) 1999;
Albert Kümmel / Petra Löffler (Hg.), Medientheorie 1888-1933. Texte und Kommentare, Frankfurt / M. (Suhrkamp) 2002;
Günter Helmes / Werner Köster (Hg.), Texte zur Medientheorie, Stuttgart 2002;
Daniela Kloock / Angela Spahr (Hg.), Medientheorien. Eine Einführung, München (UTB / Fink) 1998;
The New Media Reader, hg. v. Noah Wardrip Fruin / Nick Monfort, Cambridge, Mass. / London (MIT Press) 2003;
Alexander Roesler / Bernd Stiegler (Hg.), Grundbegriffe der Medientheorie, Paderborn (Fink) 2005
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Der Lógos Technischer Artefakte: Transitive Medientheorie als konkrete Medienarchäologie
Veranstaltungsnummer: 53505
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Adjektive wie "technisch" und die ubiquitäre Begriffsmünze "Technologie" scheinen heute so selbstverständlich, dass sie im medienkulturellen Diskurs kaum noch infrage gestellt werden. Demgegenüber gehört zu den vornehmsten Aufgaben von Medientheorie - zumal in Hegels Haus - die harte "Arbeit am Begriff". Doch im Unterschied zur rein (technik-)philosophischen Reflexion widmet sich radikal medienarchäologische Analyse zugleich ihren konkreten Verdinglichungen (Hardware) und "Undingen" (Software, mit Vilém Flusser). Eskalationen von körpergebundenen Kulturtechniken zu maschinellen Techniken und ihre Autonomisierung zur Technologie werden damit fassbar. Den Leitfaden dieser Vorlesung bildet die Technológos-Hypothese, der zufolge den techno-logischen Gefügen ein Eigenwissen respektive Eigenwe(i)sen zukommen, die sich erst im operativen Vollzug der Verwicklungen der symbolischen Codes mit maschinaler MateRealität (sic) entbergen. Das thematische Testfeld zur Verifikation solcher medientheoretischen Theoreme bildet die sogenannte Digitalisierung. "Geerdet" wird die Vorlesung in angemessenen Momenten durch die Demonstration exemplarischer Artefakte aus dem Katalógos des Medienarchäologischen Fundus im und als Medientheater.
Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik, in: ders., Reden und Aufsätze, 2. Aufl. Tübingen (Neske) 1959, 13-44;
ders., Überlieferte Sprache und technische Sprache, St. Gallen (Erker) 1989;
Vilém Flusser, Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen, München / Wien (Carl Hanser) 1993;
Benoît Turquety, Inventing Cinema: Machines, Gestures and Media History [FO 2014], Amsterdam (UP) 2019;
Moritz Hiller / Stefan Höltgen (Hg.), Archäographien. Aspekte einer Radikalen Medienarchäologie, Berlin (Schwabe Verlag) 2019;
W. E., Harte Arbeit am Begriff. Medienarchäologische Antworten auf die Frage nach der Technologie", in: Mechane. Journal of Philosophy and Anthropology of Technology; Ausgabe 0 (2020);
W. E., Technológos in Being. Radical Media Archaeology and the Computational Machine, New York et al. (Bloomsbury Academic) 2021 (Reihe Thinking Media);
Jan Distelmeyer, Kritik der Digitaltität, Wiesbaden (Springer VS) 2021
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul III - Medienarchäologie vs. Medienhistografie (10 LP)
Das kybernetische Auge: Einblicke in die Wissensgeschichte der künstlichen Intelligenz
Veranstaltungsnummer: 53524
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Sebastian Kawanami-Breu
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
In diesem Seminar wird die Entwicklung von KI-Modellen, insbesondere künstlichen neuronalen Netzwerken, im Kontext der Medien- und Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts untersucht. Hinter den maschinellen Routinen der KI steht eine längere Geschichte von Prototypen, Problemen und Praktiken, die quer durch Felder der angewandten Medientechnologie und der experimentellen Erkundung der lebendigen Wahrnehmung hindurchführt. Neben Texten über Kybernetik, Hirnforschung, Anthropometrie und frühe KI werden auch einige Ansätze der historischen Epistemologie kennengelernt, die für eine medienwissenschaftliche Analyse von KI (und generell: von Maschinenmodellen des Lebendigen) interessant sind.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Der Lógos Technischer Artefakte: Transitive Medientheorie als konkrete Medienarchäologie
Veranstaltungsnummer: 53505
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Adjektive wie "technisch" und die ubiquitäre Begriffsmünze "Technologie" scheinen heute so selbstverständlich, dass sie im medienkulturellen Diskurs kaum noch infrage gestellt werden. Demgegenüber gehört zu den vornehmsten Aufgaben von Medientheorie - zumal in Hegels Haus - die harte "Arbeit am Begriff". Doch im Unterschied zur rein (technik-)philosophischen Reflexion widmet sich radikal medienarchäologische Analyse zugleich ihren konkreten Verdinglichungen (Hardware) und "Undingen" (Software, mit Vilém Flusser). Eskalationen von körpergebundenen Kulturtechniken zu maschinellen Techniken und ihre Autonomisierung zur Technologie werden damit fassbar. Den Leitfaden dieser Vorlesung bildet die Technológos-Hypothese, der zufolge den techno-logischen Gefügen ein Eigenwissen respektive Eigenwe(i)sen zukommen, die sich erst im operativen Vollzug der Verwicklungen der symbolischen Codes mit maschinaler MateRealität (sic) entbergen. Das thematische Testfeld zur Verifikation solcher medientheoretischen Theoreme bildet die sogenannte Digitalisierung. "Geerdet" wird die Vorlesung in angemessenen Momenten durch die Demonstration exemplarischer Artefakte aus dem Katalógos des Medienarchäologischen Fundus im und als Medientheater.
Martin Heidegger, Die Frage nach der Technik, in: ders., Reden und Aufsätze, 2. Aufl. Tübingen (Neske) 1959, 13-44;
ders., Überlieferte Sprache und technische Sprache, St. Gallen (Erker) 1989;
Vilém Flusser, Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen, München / Wien (Carl Hanser) 1993;
Benoît Turquety, Inventing Cinema: Machines, Gestures and Media History [FO 2014], Amsterdam (UP) 2019;
Moritz Hiller / Stefan Höltgen (Hg.), Archäographien. Aspekte einer Radikalen Medienarchäologie, Berlin (Schwabe Verlag) 2019;
W. E., Harte Arbeit am Begriff. Medienarchäologische Antworten auf die Frage nach der Technologie", in: Mechane. Journal of Philosophy and Anthropology of Technology; Ausgabe 0 (2020);
W. E., Technológos in Being. Radical Media Archaeology and the Computational Machine, New York et al. (Bloomsbury Academic) 2021 (Reihe Thinking Media);
Jan Distelmeyer, Kritik der Digitaltität, Wiesbaden (Springer VS) 2021
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Methoden der Mediengeschichte
Veranstaltungsnummer: 53501
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Die Ringvorlesung vermittelt einen Überblick über verschiedene methodische Ansätze in der aktuellen medienhistorischen Forschung. Mit ihrer Engführung auf Methodenfragen möchte die Veranstaltung aufzeigen, dass sich die Geschichte der Medien nicht einfach in der historischen Entwicklung und Abfolge von Kulturtechniken, Medientechnologien, Produktionskulturen o.ä. erschöpft, sondern dass sie als Medienhistoriografie, d.h. als Mediengeschichtsschreibung, vielmehr ein breit gefächertes Spektrum unterschiedlicher Geschichten von Medien im Plural umfasst, die hinsichtlich ihrer Gegenstandsbereiche, Zugänge und Ziele mitunter stark differieren können. Denn erstens verändert sich mit der medientechnischen Entwicklung innerhalb wie außerhalb der Medienwissenschaft immer wieder auch die Auffassung darüber, was jeweils als „Medium“ verstanden wird bzw. problematisiert werden soll. Zweitens antwortet Medienhistoriografie auf gesellschaftliche Debatten und reagiert darüber hinaus auf Verschiebungen innerhalb des akademischen Diskurses selbst, unter deren Einwirkung sich auch die Arten und Weisen ändern, Mediengeschichte zu erzählen. Medienhistoriografie bildet dadurch nicht zuletzt auch selbst ein Objekt historischer Veränderung.
In diesem Sinne fragt die Vorlesung danach, welche Medien einerseits und welche Geschichte/n andererseits jeweils in den Fokus rücken, wenn wir, ausgehend von unserer gegenwärtigen Situation, von Mediengeschichte sprechen. Wie können oder sollten wir „die Geschichte der Medien“ heute erzählen und wie und warum sollte sie vielleicht nicht mehr erzählt werden? Wie lässt sich eine weitgehend normative Mediengeschichte (etwa „Von der Keilschrift zum Smartphone“ oder „Vom Buchdruck zu TikTok“) durch neue historische Objekte, Subjekte und Quellen, alternative Storylines oder explizite Gegengeschichten aktualisieren, problematisieren und pluralisieren?
Die Beitragenden der Ringvorlesung beantworten diese Fragen auf der Grundlage spezifischer methodischer Zugänge und anhand exemplarischer Fallbeispiele, unter anderem aus den Bereichen Medienarchäologie, Wissensgeschichte, materielle Provenienzforschung, historische Praxeologie, Mikrogeschichte, critical media history, Infrastruktur- und Infrastrukturierungsgeschichte, Web History und Digital History.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul IV - Mediendramaturgie und Medienästhetik (10 LP)
Sound & Träume
Veranstaltungsnummer: 53537
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Luana Strauss
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
„Is there a tonal order in dreams, as there is in music and poetry?“, fragt die Traumforscherin und Dramaturgin IONE in ihrem Handbuch Listening in Dreams, welches als Grundlagenlektüre der von ihrer Lebenspartnerin Pauline Oliveros begründeten Deep Listening Methodik dient. Die Praxis des tiefen Zuhörens wird damit anhand künstlerisch-experimenteller und somatischer Praktiken um sämtliche Wach-, Dämmer- und Schlafzustände erweitert. Sie stößt dabei die Tür auf in ein Forschungsfeld, in dem Sound, ähnlich wie im Film oder Theater, als selbstverständlich oder sogar nicht vorhanden erachtet wird. (Wie) können wir auf dieses flüchtige, ephemere, subjektiv geprägte Phänomen aus analytischen, empirischen und künstlerisch-situiert forschenden Perspektiven horchen? Und was lernen wir daraus über unsere eigenen Positionierungen als der Welt zugewandte zuhörend-träumend Forschende?
In den theoretisch-praktischen Blöcken nähert sich das Projekttutorium dem Themenkomplex aus zwei Richtungen: 1. sprechen wir über „Träume(n) in Sound“ mithilfe interdisziplinärer Analysen von Musikstücken aus Jazz- und Popmusik, Film und Musiktheater, welche durch ihre Inhalte, Entstehung oder Ä sthetik eine Beziehung zum Sujet des Traumes aufweisen und stellen diese in historische und globale Kontexte, 2. werden wir empirische und künstlerische Forschungsansätze ü ber „Sound in Träumen“ erproben, mit welchen wir die (auditive) Wahrnehmung unserer Träume und damit der eigenen Situiertheit reflektieren.
Als Abschlussprojekt erarbeiten wir gemeinsam eine Soundcollage, welche online veröffentlicht wird. Es besteht die freiwillige Möglichkeit, gemeinsame Traumklangforschung bei einem Ausflug mit Übernachtung in Finowfurt (Brandenburg) durchzuführen, wo ein Musikstudio zur kreativen Verarbeitung und Aufbereitung der Soundcollagen-Beiträge zur Verfügung steht.
Studierende sollten bereit sein, Träume auf regelmäßiger Basis zu dokumentieren und nach eigenem Ermessen mit der Gruppe zu teilen.
Fragen und Anregungen gerne an Keo (ohne Pronomen/sie):
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Digitalität, Materialität, Operativität
Veranstaltungsnummer: 53521
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Wann werden technologische Netzwerke und Systeme, die Informationen speichern, übertragen und komputieren zu Medien? Wie lässt sich die komplizierte Materialität, die mit digitalen Prozessen (mit Algorithmen, Daten, Software und Hardware) verschränkt ist, erfassen und verstehen? Wie viel Arbeit steckt in sozialen Medien? Solche und ähnliche Fragen werden in dieser Vorlesung aufgeworfen, besprochen und vertieft. Dabei geht es nicht um die Vermittlung von Antworten, sondern um eine Einführung in medienwissenschaftliche Perspektiven auf Digitalität, ihre Materialität und Operativität. Damit die oft unmerklich schnellen Prozesse, die mit Digitalität einhergehen, für Menschen erfassbar werden, müssen sie erst wahrnehmbar gemacht werden. Hier kommen Konzepte wie Interface, Oberfläche, Transduktion und Ästhetik ins Spiel. Spiel wiederum hat mit Handlungen und Operationen zu tun. Was passiert, wenn sich Benutzer:innen sozialer Medien über berührungsempfindliche Bildschirme per Like-Button und Kommentare über besondere Ereignisse im Alltag austauschen?
Die Vorlesung fasst die Operativität von Digitalität, das heißt die Arbeit in digitalen Medien, materialistisch auf. Dabei wird es unter anderem auch um die Unterscheidung der vielen Varianten des Materialismus gehen, die das Verständnis digitaler Medien erweitern können: Bürgerlich, kritisch, feministisch, historisch, energetisch, informationstheoretisch etc.
Erwartet wird von allen Hörer:innen eine kurze schriftliche Rückmeldung (max. 400 Wörter) jeweils nach zwei Vorlesungen durch das ganze Semester hindurch.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul V - Digitale Medien (10 LP)
Matrix Revolutions – Computergraphik, KI-Modelle und lineare Algebra I
Veranstaltungsnummer: 53527
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Sebastian Kawanami-Breu
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Dieses Seminar bietet MedienwissenschaftlerInnen die Möglichkeit, die Welt der Computergraphik und des maschinellen Lernens aus ihren technisch-mathematischen Grundlagen heraus zu erkunden. In vielen Aspekten basiert diese Welt auf dem Wissen der linearen Algebra und der Kunst, geometrische Objekte oder komplexe Datenstrukturen als Vektoren zu codieren und zu manipulieren. In einer Reihe von ausgewählten Lektüren und Übungen werden Einblicke in die wissensgeschichtlichen Koordinaten dieser “Vektorwelten” gegeben und bei der Tour durch ihre mathematischen Fundamente auch aktuelle Medientechnologien wie etwa das Rendering von 3D-Szenen in Computerspielen oder die Modellierung von Sprache und Bild in künstlichen neuronalen Netzen berühren.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Matrix Revolutions – Computergraphik, KI-Modelle und lineare Algebra II
Veranstaltungsnummer: 53528
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Angelo Papenhoff
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Digitalveranstaltung
Dieses Seminar bietet MedienwissenschaftlerInnen die Möglichkeit, die Welt der Computergraphik und des maschinellen Lernens aus ihren technisch-mathematischen Grundlagen heraus zu erkunden. In vielen Aspekten basiert diese Welt auf dem Wissen der linearen Algebra und der Kunst, geometrische Objekte oder komplexe Datenstrukturen als Vektoren zu codieren und zu manipulieren. In einer Reihe von ausgewählten Lektüren und Übungen werden Einblicke in die wissensgeschichtlichen Koordinaten dieser “Vektorwelten” gegeben und bei der Tour durch ihre mathematischen Fundamente auch aktuelle Medientechnologien wie etwa das Rendering von 3D-Szenen in Computerspielen oder die Modellierung von Sprache und Bild in künstlichen neuronalen Netzen berühren.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Digitalität, Materialität, Operativität
Veranstaltungsnummer: 53521
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Wann werden technologische Netzwerke und Systeme, die Informationen speichern, übertragen und komputieren zu Medien? Wie lässt sich die komplizierte Materialität, die mit digitalen Prozessen (mit Algorithmen, Daten, Software und Hardware) verschränkt ist, erfassen und verstehen? Wie viel Arbeit steckt in sozialen Medien? Solche und ähnliche Fragen werden in dieser Vorlesung aufgeworfen, besprochen und vertieft. Dabei geht es nicht um die Vermittlung von Antworten, sondern um eine Einführung in medienwissenschaftliche Perspektiven auf Digitalität, ihre Materialität und Operativität. Damit die oft unmerklich schnellen Prozesse, die mit Digitalität einhergehen, für Menschen erfassbar werden, müssen sie erst wahrnehmbar gemacht werden. Hier kommen Konzepte wie Interface, Oberfläche, Transduktion und Ästhetik ins Spiel. Spiel wiederum hat mit Handlungen und Operationen zu tun. Was passiert, wenn sich Benutzer:innen sozialer Medien über berührungsempfindliche Bildschirme per Like-Button und Kommentare über besondere Ereignisse im Alltag austauschen?
Die Vorlesung fasst die Operativität von Digitalität, das heißt die Arbeit in digitalen Medien, materialistisch auf. Dabei wird es unter anderem auch um die Unterscheidung der vielen Varianten des Materialismus gehen, die das Verständnis digitaler Medien erweitern können: Bürgerlich, kritisch, feministisch, historisch, energetisch, informationstheoretisch etc.
Erwartet wird von allen Hörer:innen eine kurze schriftliche Rückmeldung (max. 400 Wörter) jeweils nach zwei Vorlesungen durch das ganze Semester hindurch.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul VI - Projektmodul (10 LP)
Technik im Medientheater – Licht, Bild, Ton, Video und Bühne
Veranstaltungsnummer: Ü53525
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Erik Anton Reinhard
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Tutorium ist als offene Sprechstunde konzipiert, die Studierenden Unterstützung bei der technischen Koordination ihrer Projektarbeiten im Medientheater bietet. Es richtet sich sowohl an die Teilnehmer:innen am Projektseminar "Konzept Medientheater" als auch an andere Studierende, die eigene Projekte im Medientheater realisieren wollen.
Um wöchentliche Anmeldung wird gebeten. Die Mailadresse wird vor Semesterstart bekanntgegeben.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Konzept Medientheater
Veranstaltungsnummer: 53530
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Dr. Florian Leitner
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Medientheater am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft ist ein Labor für medienkünstlerische Performances, die u.a. von Studierenden in Projektseminaren entwickelt werden. Welche Möglichkeiten gibt es, in einem Theater Medien zum Thema zu machen? Ausgehend von dieser Frage entwickeln die Teilnehmer_innen eigene medienkünstlerische Formate und Projekte, die im Medientheater präsentiert werden.
NB: Die Teilnehmer_innen müssen ausreichend Zeit für die eigenständige Projektarbeit — ca. einen Arbeitstag pro Woche — einplanen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Klangarchäologische Studien am Synthesizer
Veranstaltungsnummer: 53531
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Christina Dörfling
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Medienstudio beheimatet eine Vielzahl analoger und digitaler Synthesizer. In Kooperation mit dessen Leiter Martin Meier widmet sich das Projektseminar ausgewählten Objekten dieser Sammlung. Der erste Teil des Seminars bietet einen Überblick der historischen Entwicklung elektronischer Musikinstrumente und vermittelt dabei wesentliche Aspekte ihrer physikalisch-technischen Grundlagen (Oszillatoren, Formen der Klangsynthese, Interfaces). Im weiteren Verlauf des Semesters setzen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit je einem der Instrumente intensiver auseinander. Die Ergebnisse dieser klangarchäologischen Studien, die neben musikalischen und klanglichen Dimensionen z.B. auch technikhistorische, materielle, ökonomische umfassen können, werden am Ende des Semesters im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert.
Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music. The Art of Hardware Hacking, 3. Aufl. Routledge 2020.
Pinch, Trevor and Franc Tocco: Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Cambridge MA 2002.
Rogers, Tara: Pink Noises. Women on Electronic Music and Sound, Durham 2010.
Ruschkowski, André: Elektronische Klänge und musikalische Entdeckungen, 2. überarb. Aufl. Stuttgart 2010.
Schulze, Hans-Jochen und Georg Engel: Moderne Musikelektronik, Militärverlag (DDR) 1989.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Medientechnisches Praktikum
Veranstaltungsnummer: 53532
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Ingolf Haedicke
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Fernab des regulären Arbeitsalltags eines Studierenden der Musik – und Medienwissenschaft, bietet diese Projektarbeit die Möglichkeit, praktisch an medientechnischen Geräten oder elektronischen Musikinstrumenten zu forschen. Unter Anleitung werden Teilnehmer selbst zu Lötkolben und Schraubendreher greifen, um beispielsweise Morse-Apparate, elektronische Musikinstrumente (Theremin, Onde Martenot, Trautonium), Plattenspieler, Lautsprecher, drahtgebundene oder drahtlose Sende- und Empfangsgeräte, Tonabnehmer (pick ups), oder Fotoapparate zu bauen. Dabei ist dieses Praktikum eine einzigartige Möglichkeit, neue Sichtweisen und Fragestellungen zu medientheoretischen Studien, wie sie vor allem im Zusammenhang mit dem medienarchäologischen Fundus betrieben werden, zu entwickeln.
Schwerpunkte sind: Schwingkreis (Funk), Resonatoren, Fotografie. Ebenso bietet dieses Praktikum die Möglichkeit, Demonstrationsmodelle für Referate zu speziellen Seminaren der Musik- und Medienwissenschaft anzufertigen. So nebenbei werden die notwendigen Grundlagen der Akustik und Elektronik vermittelt, bei Bedarf auch über die vorgegebene Praktikumszeit hinaus.
Die Erfahrung lehrt, daß das erworbene Schulwissen nach einigen Jahren nur bruchstückhaft vorhanden und abrufbar ist. Erst wenn ein medientechnisches Gerät selbst angefertigt worden ist, wird die Funktionsweise desselben so schnell nicht vergessen und überhaupt erst verstanden. Gerade in der heutigen Zeit, wo bereits das bloße Bedienen können komplizierter Geräte und apps als „intellektuelle Leistung“ verstanden wird, sind ein paar Grundlagenkenntnisse wichtiger denn je.
Elektrotechnische Vorkenntnisse sind nicht von Nöten. Eine Teilnahme kann sowohl regelmäßig, als auch sporadisch projektgebunden erfolgen und ist je nach Zeit der Studierenden auch an anderen Tagen und Stunden möglich.
Der Teilnahmewunsch wird schriftlich per E-Mail an gestellt. Dann erhalten Sie weitere Informationen u.a. zum Ort.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul VII - Wissen über Medien (ÜWP Modul) (10 LP)
Sound & Träume
Veranstaltungsnummer: 53537
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Luana Strauss
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
„Is there a tonal order in dreams, as there is in music and poetry?“, fragt die Traumforscherin und Dramaturgin IONE in ihrem Handbuch Listening in Dreams, welches als Grundlagenlektüre der von ihrer Lebenspartnerin Pauline Oliveros begründeten Deep Listening Methodik dient. Die Praxis des tiefen Zuhörens wird damit anhand künstlerisch-experimenteller und somatischer Praktiken um sämtliche Wach-, Dämmer- und Schlafzustände erweitert. Sie stößt dabei die Tür auf in ein Forschungsfeld, in dem Sound, ähnlich wie im Film oder Theater, als selbstverständlich oder sogar nicht vorhanden erachtet wird. (Wie) können wir auf dieses flüchtige, ephemere, subjektiv geprägte Phänomen aus analytischen, empirischen und künstlerisch-situiert forschenden Perspektiven horchen? Und was lernen wir daraus über unsere eigenen Positionierungen als der Welt zugewandte zuhörend-träumend Forschende?
In den theoretisch-praktischen Blöcken nähert sich das Projekttutorium dem Themenkomplex aus zwei Richtungen: 1. sprechen wir über „Träume(n) in Sound“ mithilfe interdisziplinärer Analysen von Musikstücken aus Jazz- und Popmusik, Film und Musiktheater, welche durch ihre Inhalte, Entstehung oder Ä sthetik eine Beziehung zum Sujet des Traumes aufweisen und stellen diese in historische und globale Kontexte, 2. werden wir empirische und künstlerische Forschungsansätze ü ber „Sound in Träumen“ erproben, mit welchen wir die (auditive) Wahrnehmung unserer Träume und damit der eigenen Situiertheit reflektieren.
Als Abschlussprojekt erarbeiten wir gemeinsam eine Soundcollage, welche online veröffentlicht wird. Es besteht die freiwillige Möglichkeit, gemeinsame Traumklangforschung bei einem Ausflug mit Übernachtung in Finowfurt (Brandenburg) durchzuführen, wo ein Musikstudio zur kreativen Verarbeitung und Aufbereitung der Soundcollagen-Beiträge zur Verfügung steht.
Studierende sollten bereit sein, Träume auf regelmäßiger Basis zu dokumentieren und nach eigenem Ermessen mit der Gruppe zu teilen.
Fragen und Anregungen gerne an Keo (ohne Pronomen/sie):
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Grundlagen der Medienwissenschaft für BA-Studierende
Veranstaltungsnummer: Ü53534
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Marie-Luisa Glutsch
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Tutorium dient der Einführung in die Grundlagen des medienwissenschaftlichen Arbeitens: Wie schreibe ich eigentlich eine Hausarbeit? Wie finde ich ein geeignetes Thema? Wie zitiere ich ordentlich? Im Verlauf des Tutoriums sollen Studierende Schritt für Schritt an das wissenschaftliche Schreiben herangeführt und bei der Ideenfindung für eine erste Hausarbeit begleitet werden. Außerdem soll den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, im Tutorium alle Fragen zu stellen, die sich zu Studienbeginn ergeben.
Die erste Lehrveranstaltung am Dienstag, 17. Oktober, findet für BA- und MA-Studierenden statt. Anschließend wird der Kurs im 14-tägigen Wechsel für BA- und MA-Studierende stattfinden.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul VIII - Medien des Wissens (ÜWP Modul) (10 LP)
-- Keine Lehrveranstaltung in diesem Semester --
Modul IX - Medienwissenschaft in der Praxis (ÜWP Modul) (10 LP)
Einführung in die Grundlagen der Hörfunk-Arbeit; vom klassischen Radiobeitrag bis zu Podcast-Entwicklungen
Veranstaltungsnummer:
Leistungspunkte:
Lehrende/r:
Christine Watty
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Seminar vermittelt in drei Blöcken den theoretischen Hintergrund der Radioarbeit und dient als Vorbereitung für die praktische Mitarbeit beim Campusradio der HU couchFM.Was bedeutet Radio machen in der heutigen zeit? Das Seminar zeigt anhand vieler konkreter Hörbeispiele und gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der Praxis, wie der klassische Hörfunk heute funktioniert: Wie macht man eigentlich Radio? Welche journalistischen Fragen stellen sich heute für den Hörfunk inmitten der Nachrichtenströme aus dem Netz? Welchen Herausforderungen muss sich der moderne Hörfunk stellen, wenn es um die Digitalisierungsfragen geht? Wie haben sich Formate in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und welche Rollen spielen Wort und Musik in unterschiedlichen Sendungen? Wie kann man komplizierte Inhalte fürs Audio aufbereiten und welche Rolle spielt die Moderation?Das Seminar verfolgt die Grundlagen der Radioarbeit mit Blick auch auf den aktuellen Radiomarkt und seiner unterschiedlichen Ausrichtungen. Es geht um Themen, Aufbereitung, Zielgruppen und die passende Ansprache. Und schließlich um aktuelle Podcast-Entwicklungen und die Frage: Ist das schon Konkurrenz für das Radio oder noch Ergänzung des Audiomarkts?
Neben dem Besuch des "Grundlagenseminars" ist die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern möglich, sowie daran anschließend die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM jeweils montags ca. 18 - 21 Uhr.
Bitte melde Dich bei Interesse unter
Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Scheinerwerbs.
1. Nur der Besuch des Seminars (1 LP)
2. Besuch des Seminars und Sammeln von Radioerfahrung als Mitglied im Campusradio couchFM.
Dafür ist neben dem Seminarbesuch die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern im Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) Pflicht sowie die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM.
Termine der Workshops:
Einführung ins Hörfunkstudio:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 17.30 Uhr
Radio-Darstellungsformen:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 15.00 Uhr
Sprechen fürs Hören:
Sonnabend, 11. Mai & Sonntag, 12. Mai, je 10.00 - 17.00 Uhr
Audiorekorder und -schnitt:
Sonnabend, 15. Juni & Sonntag, 16. Juni, je 10.00 - 17.00 Uhr
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul X - Campus Radio - Programm und Produktion (ÜWP Modul) (5 LP)
Einführung in die Grundlagen der Hörfunk-Arbeit; vom klassischen Radiobeitrag bis zu Podcast-Entwicklungen
Veranstaltungsnummer:
Leistungspunkte:
Lehrende/r:
Christine Watty
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Seminar vermittelt in drei Blöcken den theoretischen Hintergrund der Radioarbeit und dient als Vorbereitung für die praktische Mitarbeit beim Campusradio der HU couchFM.Was bedeutet Radio machen in der heutigen zeit? Das Seminar zeigt anhand vieler konkreter Hörbeispiele und gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der Praxis, wie der klassische Hörfunk heute funktioniert: Wie macht man eigentlich Radio? Welche journalistischen Fragen stellen sich heute für den Hörfunk inmitten der Nachrichtenströme aus dem Netz? Welchen Herausforderungen muss sich der moderne Hörfunk stellen, wenn es um die Digitalisierungsfragen geht? Wie haben sich Formate in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und welche Rollen spielen Wort und Musik in unterschiedlichen Sendungen? Wie kann man komplizierte Inhalte fürs Audio aufbereiten und welche Rolle spielt die Moderation?Das Seminar verfolgt die Grundlagen der Radioarbeit mit Blick auch auf den aktuellen Radiomarkt und seiner unterschiedlichen Ausrichtungen. Es geht um Themen, Aufbereitung, Zielgruppen und die passende Ansprache. Und schließlich um aktuelle Podcast-Entwicklungen und die Frage: Ist das schon Konkurrenz für das Radio oder noch Ergänzung des Audiomarkts?
Neben dem Besuch des "Grundlagenseminars" ist die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern möglich, sowie daran anschließend die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM jeweils montags ca. 18 - 21 Uhr.
Bitte melde Dich bei Interesse unter
Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Scheinerwerbs.
1. Nur der Besuch des Seminars (1 LP)
2. Besuch des Seminars und Sammeln von Radioerfahrung als Mitglied im Campusradio couchFM.
Dafür ist neben dem Seminarbesuch die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern im Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) Pflicht sowie die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM.
Termine der Workshops:
Einführung ins Hörfunkstudio:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 17.30 Uhr
Radio-Darstellungsformen:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 15.00 Uhr
Sprechen fürs Hören:
Sonnabend, 11. Mai & Sonntag, 12. Mai, je 10.00 - 17.00 Uhr
Audiorekorder und -schnitt:
Sonnabend, 15. Juni & Sonntag, 16. Juni, je 10.00 - 17.00 Uhr
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Master Studiengang
Modul I - Medientheorien (10 LP)
Ausklang: Sonische Zeitweisen technischer Medien
Veranstaltungsnummer: 53506
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Am hiesigen Institut sind Musikwissenschaft sowie Medienwissenschaft nicht schlicht durch ein kaltes 'und' verbunden, sondern durch ein graphisches '&' miteinander verschlungen. Es geziemt sich daher, nepistemologische Brücken zwischen Klangweisen und hochtechnischem Wissen zu schlagen. Nicht von ungefähr sind eine Reihe von Begriffen zur Beschreibung technischer Medien der Akustik und der Klangwissenschaft entliehen. Schwingungen, Resonanzen, Rhythmen und Impulse prägen das Dasein operativer Medien, d. h. ihren Vollzugscharakter in der Welt (also in der Zeit). In dieser impliziten Klanglichkeit entbirgt sich eine strukturelle Analogie hochtechnischer Prozesse und Musik. Der 'Klang' der Medien ist dabei nicht auf akustische Phänomene beschränkt; vielmehr ereigenen sich quasi-musikalische, und implizit sonische, Erscheinungen auf der medienarchäologischen Ebene selbst. Einen Schwerpunkt des Seminars bilden die Zeitweisen des Sonischen, nicht-hörbare Musikalität, sowie elektronische Klänge (Sonik).
PopScriptum X: Das Sonische – Sounds zwischen Akustik und Ästhetik (2008) Link ;
W. E., Im Medium erklingt die Zeit, Berlin (Kulturverlag Kadmos) 2015;
ders., Im Reich von δt. Medienprozesse als Spielfeld sonischer Zeit, in: Holger Schulze (Hg.), Sound Studies. Traditionen - Methoden - Desiderate. Eine Einführung, Bielefeld (transcript) 2008, 125-142;
Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig (Vieweg) 1863 (6. Aufl. 1913); Reprint Frankfurt / M. (Minerva) 1981;
Karsten Lichau / Viktoria Tkaczyk / Rebecca Wolf (Hg.), Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur, München (Fink) 2009;
Douglas Kahn, Noise, water, meat. A history of sound in the Arts, Massachusetts Institute of Technology 1999;
Veit Erlmann, Reason and Resonance. A History of Modern Aurality, New York (Zone Books) 2010;
David Espinet, Phänomenologie des Hörens. Eine Untersuchung im Ausgang von Martin Heidegger, Tübingen (Mohr Siebeck) 2009;
Dieter Daniels / Sandra Naumann (Hg.), Audiovisuology. Essays: Histories and Theories of Audiovisual Media and Arts, Köln (Walther König) 2011;
W. E., Im Medium erklingt die Zeit. Technologische Tempor(e)alitäten und das Sonische als ihre privilegierte Erkenntnisform, Berlin (Kulturverlag Kadmos) 2015
Neben der aufmerksamen Textlektüre und dem regelmäßigen Seminarbesuch dient die Übernahme eines Referats der Teilnahmebescheinigung: eine kurze Einführung in den wöchentlich zu lesenden (und dann vom Seminar gemeinsam besprochenen) Text, wie er unter Moodle abgelegt ist. Die konkrete Gestaltung und Gewichtung dieses "reading response" steht den Referent*innen frei.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul II - Medienhistoriografie vs. Medienarchäologie (10 LP)
Medienhistoriografische Methoden (Begleitseminar zur Ringvorlesung)
Veranstaltungsnummer: 53502
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Begleitseminar zur Ringvorlesung „Methoden der Mediengeschichte“ (53501) bietet die Möglichkeit, die im Rahmen der Ring-VL verhandelten Inhalte und methodischen Ansätze zu wiederholen und zu vertiefen. Dazu lesen und diskutieren Sie Texte zu aktuellen medienhistorischen Ansätzen sowie exemplarische medienhistorische Analysen, unter anderem aus den Bereichen Medienarchäologie, Wissensgeschichte, historische Praxeologie, Mikrogeschichte, kritische Mediengeschichte, Infrastruktur- und Infrastrukturierungsgeschichte, Web History und Social-Media- bzw. Platform-Geschichte. Neben der Aufbereitung und Diskussion der Seminarlektüre haben Sie im Rahmen von Übungen und kleinen Workshops die Möglichkeit, den Umgang mit unterschiedlichen historischen Quellen praktisch zu erproben und die verschiedenen Zugänge auf eigene Forschungsgegenstände anzuwenden.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Methoden der Mediengeschichte
Veranstaltungsnummer: 53501
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Die Ringvorlesung vermittelt einen Überblick über verschiedene methodische Ansätze in der aktuellen medienhistorischen Forschung. Mit ihrer Engführung auf Methodenfragen möchte die Veranstaltung aufzeigen, dass sich die Geschichte der Medien nicht einfach in der historischen Entwicklung und Abfolge von Kulturtechniken, Medientechnologien, Produktionskulturen o.ä. erschöpft, sondern dass sie als Medienhistoriografie, d.h. als Mediengeschichtsschreibung, vielmehr ein breit gefächertes Spektrum unterschiedlicher Geschichten von Medien im Plural umfasst, die hinsichtlich ihrer Gegenstandsbereiche, Zugänge und Ziele mitunter stark differieren können. Denn erstens verändert sich mit der medientechnischen Entwicklung innerhalb wie außerhalb der Medienwissenschaft immer wieder auch die Auffassung darüber, was jeweils als „Medium“ verstanden wird bzw. problematisiert werden soll. Zweitens antwortet Medienhistoriografie auf gesellschaftliche Debatten und reagiert darüber hinaus auf Verschiebungen innerhalb des akademischen Diskurses selbst, unter deren Einwirkung sich auch die Arten und Weisen ändern, Mediengeschichte zu erzählen. Medienhistoriografie bildet dadurch nicht zuletzt auch selbst ein Objekt historischer Veränderung.
In diesem Sinne fragt die Vorlesung danach, welche Medien einerseits und welche Geschichte/n andererseits jeweils in den Fokus rücken, wenn wir, ausgehend von unserer gegenwärtigen Situation, von Mediengeschichte sprechen. Wie können oder sollten wir „die Geschichte der Medien“ heute erzählen und wie und warum sollte sie vielleicht nicht mehr erzählt werden? Wie lässt sich eine weitgehend normative Mediengeschichte (etwa „Von der Keilschrift zum Smartphone“ oder „Vom Buchdruck zu TikTok“) durch neue historische Objekte, Subjekte und Quellen, alternative Storylines oder explizite Gegengeschichten aktualisieren, problematisieren und pluralisieren?
Die Beitragenden der Ringvorlesung beantworten diese Fragen auf der Grundlage spezifischer methodischer Zugänge und anhand exemplarischer Fallbeispiele, unter anderem aus den Bereichen Medienarchäologie, Wissensgeschichte, materielle Provenienzforschung, historische Praxeologie, Mikrogeschichte, critical media history, Infrastruktur- und Infrastrukturierungsgeschichte, Web History und Digital History.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul III - Politiken des Medialen (10 LP)
Mediale Infrastrukturen und infrastrukturelle Medien
Veranstaltungsnummer: 53503
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Der Begriff der Infrastruktur hat in den Medienwissenschaft in den letzten Jahren eine Konjunktur erfahren, einige Wissenschaftler:innen sprechen sogar vom „Infrastrukturalismus“ als einem an den Strukturalismus und Poststrukturalismus anschließenden wissenschaftlichen Programm. Dieser Umstand vermag aus medienwissenschaftlicher Sicht zunächst kaum zu überraschen, bilden Infrastrukturen doch schon immer die strukturellen und materiellen Möglichkeitsbedingungen von Kommunikation. Tatsächlich stellt das Interesse der Medienwissenschaft an „Infrastruktur“ als Gegenstand und Begriff ein relativ junges Phänomen dar – noch vor einem Jahrzehnt war es z.B. eher üblich, von Mediensystemen anstatt von Medieninfrastrukturen zu sprechen. Worin besteht also das Versprechen bzw. der theoretisch-methodische Mehrwert des Begriffs gerade für die aktuelle medienwissenschaftliche Forschung? Was umfasst der Begriff „Infrastruktur“ genau und wo liegen seine Grenzen? Was bedeutet es, Medien aus infrastruktureller Perspektive zu untersuchen und welche Gegenstände und Zusammenhänge rückt eine solche Perspektive in den Blick? Das Seminar verfolgt die Geschichte des Infrastrukturkonzepts von einer Akteurskategorie im Sinne eines im öffentlichen Diskurs verwendeten Schlagworts zu einem analytischen Begriff der Geistes- und Sozialwissenschaften und zielt darauf ab, anhand von einschlägigen theoretischen Texten und Fallstudien zur Infrastrukturforschung und -theorie aus der Medienwissenschaft und angrenzenden Disziplinen (darunter der Geschichte, der Wissenschafts- und Technikforschung, der Soziologie, der Anthropologie, den Urban Studies und den Literaturwissenschaften) Sichtweisen, Ansätze und Werkzeuge für eine zeitgemäße kritische Medienforschung bereit zu stellen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
DDR Soundscapes
Veranstaltungsnummer: 53519
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Christina Dörfling
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Konzept der Soundscapes, das in den 1960er und 1970er Jahren in Nordamerika v.a. im Kontext akustischer Ökologien etabliert wurde und seitdem zahlreiche methodische und disziplinäre Ausdifferenzierungen erfahren hat, sensibilisiert für die auditive Dimension von Umwelten. Demnach kommen Klänge nicht nur in Landschaften und Räumen vor, sondern sind reziprok auch an deren Hervorbringung und Konsolidierung beteiligt. In ihrer Beschreibung vergangener auditiver Kulturen perspektivierten jüngere medien- und wissensgeschichtliche Studien den Ansatz auf die sozialen Funktionen und kulturellen Bedeutungen, Machtstrukturen und Politiken spezifischer historischer Klangräume. Nachdem in einem ersten Schritt Auszüge exemplarischer Studien gelesen sowie methodische Potentiale und Grenzen des Forschungsansatzes diskutiert wurden, widmet sich das Seminar den (möglichen) Soundscapes der DDR. Wie klang die DDR? Und: wie und welche Klänge formten die DDR? In den jeweiligen Fallstudien gilt das besondere Ohrenmerk dabei der Rolle von Medientechnologien, u.a. in der Herausbildung akustischer Infrastrukturen aber auch (nicht)institutionalisierter Hör- und Klangpraktiken.
Bijsterveld, Karin (Hg.): Soundscapes of the Urban Past. Staged Sound as Mediated Cultural Heritage. Bielefeld 2013.
Birdsall, Carolyn: Nazi Soundscapes. Sound, Technology and Urban Space in Germany, 1933–1945. Amsterdam 2012.
Paul, Gerhard: „In einem stillen Land. Soundscape DDR“, in: Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute, hrsg. v. dems. und Ralph Schock, Bonn 2013, S. 476–481.
Thompson, Emily: The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge, MA 2002.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Waste, Infrastructure, and the Afterlife of Media
Veranstaltungsnummer: 53526
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Dr. Tamar Novick
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Studies of waste in the social sciences have tended to focus on the symbolic level, considering waste a mere social construct. This seminar, by contrast, takes a material approach to waste analysis. It brings together literature from the fields of history of science, science and technology studies (STS), media studies, and discard studies to think about how the material properties of waste shape our understanding and management of waste and the infrastructures that allow or prohibit waste’s movement and discard. The discussion will center on the waste of the body and at the end of media, and on the emotional and sensory registers that emerge in relation to such materials. By so doing, the seminar addresses larger questions about the connection between the social and material orders, and about the potential for finding value and meaning in waste.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Politische Medienästhetik 1923, 1973, 2023
Veranstaltungsnummer: 53520
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Zwischen 2023, 1973 und 1923 liegt jeweils ein halbes Jahrhundert. Im Seminar werden wir ausgehend von den drei Jahresangaben sowohl medien- als auch gesellschafts- und wirtschaftshistorische Tiefenbohrungen vornehmen und das gefundene Material aus bildender Kunst und Gestaltung, Musik, Tanz, Theater sowie Medienkunst bezüglich ihrer politischen Dimension befragen: Die drei Jahre sind allesamt Krisenjahre (Hyperinflation nach dem 1. Weltkrieg 1923, Ölkrise und Putsch in Chile 1973, Klimakrise und Kriege in der Ukraine, Israel und Gaza 2023). Als grobe medienwissenschaftliche Annahme gilt dabei die These, dass ästhetische Artikulation im 20. und 21. Jahrhundert sowohl durch die Operativität der historisch jeweils "neuen" Medien, die diese Artikulation erst produzieren als auch durch die gesellschaftspolitischen Mächte, die die "neuen" Medien instrumentalisieren, geprägt werden. Im Seminar werden wir diese Annahme anhand konkreter Konstellationen überprüfen und währenddessen medienwissenschaftlich informierte Erkenntnisse in Bezug auf 1923, 1973 und 2023 generieren.
Erwartet wird eine aktive Mitarbeit bei der Quellenlektüre, der Erarbeitung der Sekundärliteratur und der medienwissenschaftlichen Analyse und Beschreibung ästhetischer Artefakte.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul IV - Mediendramaturgie und Medienästhetik (10 LP)
Lesen mit ChatGPT & Co.: Texte zur Medienästhetik
Veranstaltungsnummer: 53516
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Dr. Florian Leitner
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Wie bei allen universitären Seminaren handelt es sich auch bei dieser Veranstaltung im Kern um eine Lektüregruppe, in der theoretische Texte diskutiert werden. Gleichzeitig soll in dem Seminar ausgelotet werden, wie sich dieses althergebrachte Format mithilfe von KI-Software sinnvoll ergänzen lässt, z.B. durch den Einsatz von ChatGPT als Lektüre- oder Schreibwerkzeug.
Die Textauswahl wird der inter- und transdiziplinären Basis der Medienwissenschaft im Allgemeinen und des Forschungsfelds Mediendramaturgie und -ästhetik im Besonderen Rechnung tragen und sich auch auf Bereiche wie z.B. Theater- und Performancetheorie, philosophische Ästhetische Theorie, Psychoanalyse und Wahrnehmungspsychologie erstrecken. Das Seminar richtet sich damit sowohl an Studierende, die sich am Beginn des MA-Studiums eine Orientierung über zentrale Theoriepositionen im Bereich Mediendramaturgie und Medienästhetik verschaffen wollen, als auch an solche, die am Ende des Studiums auf der Suche nach Ideen für mögliche theoretische Grundlagen einer Abschlussarbeit sind.
NB: Alle Seminarteilnehmer_innen müssen in der ersten Sitzung anwesend sein. Ein über Agnes zugeteilter Seminarplatz geht bei unentschuldigter Abwesenheit in der ersten Sitzung verloren.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Entangled: Tanz – Film – Performance
Veranstaltungsnummer: 53529
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Dr. Cornelia Lund
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Filmisch bewegtes Bild, Tanz und Performance können auf vielfältige Weise zusammenkommen: Einmal kann Film der dokumentarischen Aufzeichnung von Tanz und Performance dienen. Tanz kann aber auch explizit für das filmische Bild oder durch dieses hergestellt sein: als tänzerische Bewegung von Licht, Formen und Objekten, wie im experimentellen Film der 1920er und 1930er Jahre. Oder als Filmtanz, der sich, wie bei Maya Deren oder im Videotanz, um den bewegten menschlichen Körper zentriert, aber die medialen Möglichkeiten nutzt, um mittels Kamera, Schnitt und Montage einen genuin filmischen Tanz herzustellen. Im Tanz- oder Musicalfilm, der seinen Höhepunkt im Hollywood-Kino der 1930er Jahre erlebte, sind Tanznummern in die Handlung eingebettet und können von dort aus Eigendynamik entfalten. Im Zuge der Entwicklung von Software zur Realtime-Steuerung finden heute filmisches Bild, Musik und (tänzerische) Performance verstärkt als performative Live-Kombination zusammen.
Das Seminar möchte einen Einblick geben in die historischen und theoretischen Grundlagen der Verbindung von Film, Tanz und Performance sowie zeitgenössische Beispiele und ihre medialen Umfelder diskutieren.
Es ist angedacht, auch Veranstaltungen zum Thema in Berlin zu besuchen.
Zur Einführung:
Köhler, Kristina (2017). Der tänzerische Film. Frühe Filmkultur und moderner Tanz. Marburg: Schüren,
Lund, Cornelia (2010): "Filmtanz, Tanzfilm und getanzter Film" / "Cinedance, Dance in Cinema, and Dancing Cinema", Webplattform: www.see-this-sound.at
Salter, Chris (2010). Entangled. Technology and the Transformation of Performance. Cambridge MA/London: MIT Press.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Politische Medienästhetik 1923, 1973, 2023
Veranstaltungsnummer: 53520
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Zwischen 2023, 1973 und 1923 liegt jeweils ein halbes Jahrhundert. Im Seminar werden wir ausgehend von den drei Jahresangaben sowohl medien- als auch gesellschafts- und wirtschaftshistorische Tiefenbohrungen vornehmen und das gefundene Material aus bildender Kunst und Gestaltung, Musik, Tanz, Theater sowie Medienkunst bezüglich ihrer politischen Dimension befragen: Die drei Jahre sind allesamt Krisenjahre (Hyperinflation nach dem 1. Weltkrieg 1923, Ölkrise und Putsch in Chile 1973, Klimakrise und Kriege in der Ukraine, Israel und Gaza 2023). Als grobe medienwissenschaftliche Annahme gilt dabei die These, dass ästhetische Artikulation im 20. und 21. Jahrhundert sowohl durch die Operativität der historisch jeweils "neuen" Medien, die diese Artikulation erst produzieren als auch durch die gesellschaftspolitischen Mächte, die die "neuen" Medien instrumentalisieren, geprägt werden. Im Seminar werden wir diese Annahme anhand konkreter Konstellationen überprüfen und währenddessen medienwissenschaftlich informierte Erkenntnisse in Bezug auf 1923, 1973 und 2023 generieren.
Erwartet wird eine aktive Mitarbeit bei der Quellenlektüre, der Erarbeitung der Sekundärliteratur und der medienwissenschaftlichen Analyse und Beschreibung ästhetischer Artefakte.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul V - Digitale Medien (10 LP)
-- Keine Lehrveranstaltung in diesem Semester --
Modul VI - Vertiefung Medienepistemologie, -archäologie und -historiografie (10 LP)
Medienhistoriografische Methoden (Begleitseminar zur Ringvorlesung)
Veranstaltungsnummer: 53502
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Begleitseminar zur Ringvorlesung „Methoden der Mediengeschichte“ (53501) bietet die Möglichkeit, die im Rahmen der Ring-VL verhandelten Inhalte und methodischen Ansätze zu wiederholen und zu vertiefen. Dazu lesen und diskutieren Sie Texte zu aktuellen medienhistorischen Ansätzen sowie exemplarische medienhistorische Analysen, unter anderem aus den Bereichen Medienarchäologie, Wissensgeschichte, historische Praxeologie, Mikrogeschichte, kritische Mediengeschichte, Infrastruktur- und Infrastrukturierungsgeschichte, Web History und Social-Media- bzw. Platform-Geschichte. Neben der Aufbereitung und Diskussion der Seminarlektüre haben Sie im Rahmen von Übungen und kleinen Workshops die Möglichkeit, den Umgang mit unterschiedlichen historischen Quellen praktisch zu erproben und die verschiedenen Zugänge auf eigene Forschungsgegenstände anzuwenden.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Methoden der Mediengeschichte
Veranstaltungsnummer: 53501
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Vorlesung /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Die Ringvorlesung vermittelt einen Überblick über verschiedene methodische Ansätze in der aktuellen medienhistorischen Forschung. Mit ihrer Engführung auf Methodenfragen möchte die Veranstaltung aufzeigen, dass sich die Geschichte der Medien nicht einfach in der historischen Entwicklung und Abfolge von Kulturtechniken, Medientechnologien, Produktionskulturen o.ä. erschöpft, sondern dass sie als Medienhistoriografie, d.h. als Mediengeschichtsschreibung, vielmehr ein breit gefächertes Spektrum unterschiedlicher Geschichten von Medien im Plural umfasst, die hinsichtlich ihrer Gegenstandsbereiche, Zugänge und Ziele mitunter stark differieren können. Denn erstens verändert sich mit der medientechnischen Entwicklung innerhalb wie außerhalb der Medienwissenschaft immer wieder auch die Auffassung darüber, was jeweils als „Medium“ verstanden wird bzw. problematisiert werden soll. Zweitens antwortet Medienhistoriografie auf gesellschaftliche Debatten und reagiert darüber hinaus auf Verschiebungen innerhalb des akademischen Diskurses selbst, unter deren Einwirkung sich auch die Arten und Weisen ändern, Mediengeschichte zu erzählen. Medienhistoriografie bildet dadurch nicht zuletzt auch selbst ein Objekt historischer Veränderung.
In diesem Sinne fragt die Vorlesung danach, welche Medien einerseits und welche Geschichte/n andererseits jeweils in den Fokus rücken, wenn wir, ausgehend von unserer gegenwärtigen Situation, von Mediengeschichte sprechen. Wie können oder sollten wir „die Geschichte der Medien“ heute erzählen und wie und warum sollte sie vielleicht nicht mehr erzählt werden? Wie lässt sich eine weitgehend normative Mediengeschichte (etwa „Von der Keilschrift zum Smartphone“ oder „Vom Buchdruck zu TikTok“) durch neue historische Objekte, Subjekte und Quellen, alternative Storylines oder explizite Gegengeschichten aktualisieren, problematisieren und pluralisieren?
Die Beitragenden der Ringvorlesung beantworten diese Fragen auf der Grundlage spezifischer methodischer Zugänge und anhand exemplarischer Fallbeispiele, unter anderem aus den Bereichen Medienarchäologie, Wissensgeschichte, materielle Provenienzforschung, historische Praxeologie, Mikrogeschichte, critical media history, Infrastruktur- und Infrastrukturierungsgeschichte, Web History und Digital History.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Ausklang: Sonische Zeitweisen technischer Medien
Veranstaltungsnummer: 53506
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Am hiesigen Institut sind Musikwissenschaft sowie Medienwissenschaft nicht schlicht durch ein kaltes 'und' verbunden, sondern durch ein graphisches '&' miteinander verschlungen. Es geziemt sich daher, nepistemologische Brücken zwischen Klangweisen und hochtechnischem Wissen zu schlagen. Nicht von ungefähr sind eine Reihe von Begriffen zur Beschreibung technischer Medien der Akustik und der Klangwissenschaft entliehen. Schwingungen, Resonanzen, Rhythmen und Impulse prägen das Dasein operativer Medien, d. h. ihren Vollzugscharakter in der Welt (also in der Zeit). In dieser impliziten Klanglichkeit entbirgt sich eine strukturelle Analogie hochtechnischer Prozesse und Musik. Der 'Klang' der Medien ist dabei nicht auf akustische Phänomene beschränkt; vielmehr ereigenen sich quasi-musikalische, und implizit sonische, Erscheinungen auf der medienarchäologischen Ebene selbst. Einen Schwerpunkt des Seminars bilden die Zeitweisen des Sonischen, nicht-hörbare Musikalität, sowie elektronische Klänge (Sonik).
PopScriptum X: Das Sonische – Sounds zwischen Akustik und Ästhetik (2008) Link ;
W. E., Im Medium erklingt die Zeit, Berlin (Kulturverlag Kadmos) 2015;
ders., Im Reich von δt. Medienprozesse als Spielfeld sonischer Zeit, in: Holger Schulze (Hg.), Sound Studies. Traditionen - Methoden - Desiderate. Eine Einführung, Bielefeld (transcript) 2008, 125-142;
Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig (Vieweg) 1863 (6. Aufl. 1913); Reprint Frankfurt / M. (Minerva) 1981;
Karsten Lichau / Viktoria Tkaczyk / Rebecca Wolf (Hg.), Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur, München (Fink) 2009;
Douglas Kahn, Noise, water, meat. A history of sound in the Arts, Massachusetts Institute of Technology 1999;
Veit Erlmann, Reason and Resonance. A History of Modern Aurality, New York (Zone Books) 2010;
David Espinet, Phänomenologie des Hörens. Eine Untersuchung im Ausgang von Martin Heidegger, Tübingen (Mohr Siebeck) 2009;
Dieter Daniels / Sandra Naumann (Hg.), Audiovisuology. Essays: Histories and Theories of Audiovisual Media and Arts, Köln (Walther König) 2011;
W. E., Im Medium erklingt die Zeit. Technologische Tempor(e)alitäten und das Sonische als ihre privilegierte Erkenntnisform, Berlin (Kulturverlag Kadmos) 2015
Neben der aufmerksamen Textlektüre und dem regelmäßigen Seminarbesuch dient die Übernahme eines Referats der Teilnahmebescheinigung: eine kurze Einführung in den wöchentlich zu lesenden (und dann vom Seminar gemeinsam besprochenen) Text, wie er unter Moodle abgelegt ist. Die konkrete Gestaltung und Gewichtung dieses "reading response" steht den Referent*innen frei.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul VII - Vertiefung Angewandte Medienwissenschaft (Digitale Medien, Mediendramaturgie) (10 LP)
Lesen mit ChatGPT & Co.: Texte zur Medienästhetik
Veranstaltungsnummer: 53516
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Dr. Florian Leitner
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Wie bei allen universitären Seminaren handelt es sich auch bei dieser Veranstaltung im Kern um eine Lektüregruppe, in der theoretische Texte diskutiert werden. Gleichzeitig soll in dem Seminar ausgelotet werden, wie sich dieses althergebrachte Format mithilfe von KI-Software sinnvoll ergänzen lässt, z.B. durch den Einsatz von ChatGPT als Lektüre- oder Schreibwerkzeug.
Die Textauswahl wird der inter- und transdiziplinären Basis der Medienwissenschaft im Allgemeinen und des Forschungsfelds Mediendramaturgie und -ästhetik im Besonderen Rechnung tragen und sich auch auf Bereiche wie z.B. Theater- und Performancetheorie, philosophische Ästhetische Theorie, Psychoanalyse und Wahrnehmungspsychologie erstrecken. Das Seminar richtet sich damit sowohl an Studierende, die sich am Beginn des MA-Studiums eine Orientierung über zentrale Theoriepositionen im Bereich Mediendramaturgie und Medienästhetik verschaffen wollen, als auch an solche, die am Ende des Studiums auf der Suche nach Ideen für mögliche theoretische Grundlagen einer Abschlussarbeit sind.
NB: Alle Seminarteilnehmer_innen müssen in der ersten Sitzung anwesend sein. Ein über Agnes zugeteilter Seminarplatz geht bei unentschuldigter Abwesenheit in der ersten Sitzung verloren.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Mediale Infrastrukturen und infrastrukturelle Medien
Veranstaltungsnummer: 53503
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Der Begriff der Infrastruktur hat in den Medienwissenschaft in den letzten Jahren eine Konjunktur erfahren, einige Wissenschaftler:innen sprechen sogar vom „Infrastrukturalismus“ als einem an den Strukturalismus und Poststrukturalismus anschließenden wissenschaftlichen Programm. Dieser Umstand vermag aus medienwissenschaftlicher Sicht zunächst kaum zu überraschen, bilden Infrastrukturen doch schon immer die strukturellen und materiellen Möglichkeitsbedingungen von Kommunikation. Tatsächlich stellt das Interesse der Medienwissenschaft an „Infrastruktur“ als Gegenstand und Begriff ein relativ junges Phänomen dar – noch vor einem Jahrzehnt war es z.B. eher üblich, von Mediensystemen anstatt von Medieninfrastrukturen zu sprechen. Worin besteht also das Versprechen bzw. der theoretisch-methodische Mehrwert des Begriffs gerade für die aktuelle medienwissenschaftliche Forschung? Was umfasst der Begriff „Infrastruktur“ genau und wo liegen seine Grenzen? Was bedeutet es, Medien aus infrastruktureller Perspektive zu untersuchen und welche Gegenstände und Zusammenhänge rückt eine solche Perspektive in den Blick? Das Seminar verfolgt die Geschichte des Infrastrukturkonzepts von einer Akteurskategorie im Sinne eines im öffentlichen Diskurs verwendeten Schlagworts zu einem analytischen Begriff der Geistes- und Sozialwissenschaften und zielt darauf ab, anhand von einschlägigen theoretischen Texten und Fallstudien zur Infrastrukturforschung und -theorie aus der Medienwissenschaft und angrenzenden Disziplinen (darunter der Geschichte, der Wissenschafts- und Technikforschung, der Soziologie, der Anthropologie, den Urban Studies und den Literaturwissenschaften) Sichtweisen, Ansätze und Werkzeuge für eine zeitgemäße kritische Medienforschung bereit zu stellen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
DDR Soundscapes
Veranstaltungsnummer: 53519
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Christina Dörfling
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Konzept der Soundscapes, das in den 1960er und 1970er Jahren in Nordamerika v.a. im Kontext akustischer Ökologien etabliert wurde und seitdem zahlreiche methodische und disziplinäre Ausdifferenzierungen erfahren hat, sensibilisiert für die auditive Dimension von Umwelten. Demnach kommen Klänge nicht nur in Landschaften und Räumen vor, sondern sind reziprok auch an deren Hervorbringung und Konsolidierung beteiligt. In ihrer Beschreibung vergangener auditiver Kulturen perspektivierten jüngere medien- und wissensgeschichtliche Studien den Ansatz auf die sozialen Funktionen und kulturellen Bedeutungen, Machtstrukturen und Politiken spezifischer historischer Klangräume. Nachdem in einem ersten Schritt Auszüge exemplarischer Studien gelesen sowie methodische Potentiale und Grenzen des Forschungsansatzes diskutiert wurden, widmet sich das Seminar den (möglichen) Soundscapes der DDR. Wie klang die DDR? Und: wie und welche Klänge formten die DDR? In den jeweiligen Fallstudien gilt das besondere Ohrenmerk dabei der Rolle von Medientechnologien, u.a. in der Herausbildung akustischer Infrastrukturen aber auch (nicht)institutionalisierter Hör- und Klangpraktiken.
Bijsterveld, Karin (Hg.): Soundscapes of the Urban Past. Staged Sound as Mediated Cultural Heritage. Bielefeld 2013.
Birdsall, Carolyn: Nazi Soundscapes. Sound, Technology and Urban Space in Germany, 1933–1945. Amsterdam 2012.
Paul, Gerhard: „In einem stillen Land. Soundscape DDR“, in: Sound des Jahrhunderts. Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute, hrsg. v. dems. und Ralph Schock, Bonn 2013, S. 476–481.
Thompson, Emily: The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge, MA 2002.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Politische Medienästhetik 1923, 1973, 2023
Veranstaltungsnummer: 53520
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Zwischen 2023, 1973 und 1923 liegt jeweils ein halbes Jahrhundert. Im Seminar werden wir ausgehend von den drei Jahresangaben sowohl medien- als auch gesellschafts- und wirtschaftshistorische Tiefenbohrungen vornehmen und das gefundene Material aus bildender Kunst und Gestaltung, Musik, Tanz, Theater sowie Medienkunst bezüglich ihrer politischen Dimension befragen: Die drei Jahre sind allesamt Krisenjahre (Hyperinflation nach dem 1. Weltkrieg 1923, Ölkrise und Putsch in Chile 1973, Klimakrise und Kriege in der Ukraine, Israel und Gaza 2023). Als grobe medienwissenschaftliche Annahme gilt dabei die These, dass ästhetische Artikulation im 20. und 21. Jahrhundert sowohl durch die Operativität der historisch jeweils "neuen" Medien, die diese Artikulation erst produzieren als auch durch die gesellschaftspolitischen Mächte, die die "neuen" Medien instrumentalisieren, geprägt werden. Im Seminar werden wir diese Annahme anhand konkreter Konstellationen überprüfen und währenddessen medienwissenschaftlich informierte Erkenntnisse in Bezug auf 1923, 1973 und 2023 generieren.
Erwartet wird eine aktive Mitarbeit bei der Quellenlektüre, der Erarbeitung der Sekundärliteratur und der medienwissenschaftlichen Analyse und Beschreibung ästhetischer Artefakte.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul VIII - Projektmodul (10 LP)
Technik im Medientheater – Licht, Bild, Ton, Video und Bühne
Veranstaltungsnummer: Ü53525
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Erik Anton Reinhard
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Tutorium ist als offene Sprechstunde konzipiert, die Studierenden Unterstützung bei der technischen Koordination ihrer Projektarbeiten im Medientheater bietet. Es richtet sich sowohl an die Teilnehmer:innen am Projektseminar "Konzept Medientheater" als auch an andere Studierende, die eigene Projekte im Medientheater realisieren wollen.
Um wöchentliche Anmeldung wird gebeten. Die Mailadresse wird vor Semesterstart bekanntgegeben.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Konzept Medientheater
Veranstaltungsnummer: 53530
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Dr. Florian Leitner
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Medientheater am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft ist ein Labor für medienkünstlerische Performances, die u.a. von Studierenden in Projektseminaren entwickelt werden. Welche Möglichkeiten gibt es, in einem Theater Medien zum Thema zu machen? Ausgehend von dieser Frage entwickeln die Teilnehmer_innen eigene medienkünstlerische Formate und Projekte, die im Medientheater präsentiert werden.
NB: Die Teilnehmer_innen müssen ausreichend Zeit für die eigenständige Projektarbeit — ca. einen Arbeitstag pro Woche — einplanen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Klangarchäologische Studien am Synthesizer
Veranstaltungsnummer: 53531
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Christina Dörfling
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Medienstudio beheimatet eine Vielzahl analoger und digitaler Synthesizer. In Kooperation mit dessen Leiter Martin Meier widmet sich das Projektseminar ausgewählten Objekten dieser Sammlung. Der erste Teil des Seminars bietet einen Überblick der historischen Entwicklung elektronischer Musikinstrumente und vermittelt dabei wesentliche Aspekte ihrer physikalisch-technischen Grundlagen (Oszillatoren, Formen der Klangsynthese, Interfaces). Im weiteren Verlauf des Semesters setzen sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit je einem der Instrumente intensiver auseinander. Die Ergebnisse dieser klangarchäologischen Studien, die neben musikalischen und klanglichen Dimensionen z.B. auch technikhistorische, materielle, ökonomische umfassen können, werden am Ende des Semesters im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert.
Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music. The Art of Hardware Hacking, 3. Aufl. Routledge 2020.
Pinch, Trevor and Franc Tocco: Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Cambridge MA 2002.
Rogers, Tara: Pink Noises. Women on Electronic Music and Sound, Durham 2010.
Ruschkowski, André: Elektronische Klänge und musikalische Entdeckungen, 2. überarb. Aufl. Stuttgart 2010.
Schulze, Hans-Jochen und Georg Engel: Moderne Musikelektronik, Militärverlag (DDR) 1989.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Medientechnisches Praktikum
Veranstaltungsnummer: 53532
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Ingolf Haedicke
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Fernab des regulären Arbeitsalltags eines Studierenden der Musik – und Medienwissenschaft, bietet diese Projektarbeit die Möglichkeit, praktisch an medientechnischen Geräten oder elektronischen Musikinstrumenten zu forschen. Unter Anleitung werden Teilnehmer selbst zu Lötkolben und Schraubendreher greifen, um beispielsweise Morse-Apparate, elektronische Musikinstrumente (Theremin, Onde Martenot, Trautonium), Plattenspieler, Lautsprecher, drahtgebundene oder drahtlose Sende- und Empfangsgeräte, Tonabnehmer (pick ups), oder Fotoapparate zu bauen. Dabei ist dieses Praktikum eine einzigartige Möglichkeit, neue Sichtweisen und Fragestellungen zu medientheoretischen Studien, wie sie vor allem im Zusammenhang mit dem medienarchäologischen Fundus betrieben werden, zu entwickeln.
Schwerpunkte sind: Schwingkreis (Funk), Resonatoren, Fotografie. Ebenso bietet dieses Praktikum die Möglichkeit, Demonstrationsmodelle für Referate zu speziellen Seminaren der Musik- und Medienwissenschaft anzufertigen. So nebenbei werden die notwendigen Grundlagen der Akustik und Elektronik vermittelt, bei Bedarf auch über die vorgegebene Praktikumszeit hinaus.
Die Erfahrung lehrt, daß das erworbene Schulwissen nach einigen Jahren nur bruchstückhaft vorhanden und abrufbar ist. Erst wenn ein medientechnisches Gerät selbst angefertigt worden ist, wird die Funktionsweise desselben so schnell nicht vergessen und überhaupt erst verstanden. Gerade in der heutigen Zeit, wo bereits das bloße Bedienen können komplizierter Geräte und apps als „intellektuelle Leistung“ verstanden wird, sind ein paar Grundlagenkenntnisse wichtiger denn je.
Elektrotechnische Vorkenntnisse sind nicht von Nöten. Eine Teilnahme kann sowohl regelmäßig, als auch sporadisch projektgebunden erfolgen und ist je nach Zeit der Studierenden auch an anderen Tagen und Stunden möglich.
Der Teilnahmewunsch wird schriftlich per E-Mail an gestellt. Dann erhalten Sie weitere Informationen u.a. zum Ort.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Forschungsseminar Digitalität, Kritik und Commoning
Veranstaltungsnummer: 53533
Leistungspunkte: 5
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Im Rahmen eines kleinen Forschungsprojektes werden Sie sich intensiv mit einem eigenständigen Thema im Bereich digitale Medien, Digitalität, Commoning und kritische Medienarchäologie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch (im Signallabor) auseinandersetzen. Das Miniprojekt kann als Vorbereitung für die Abschlussarbeit (MA Medienwissenschaft) unter meiner Betreuung verstanden werden, muss es aber nicht. Die Teilnahme kann sowohl regelmäßig als auch sporadisch projektgebunden erfolgen und ist je nach Zeit der Studierenden auch an anderen Tagen und Stunden möglich. Die Teilnehmer:innen müssen jedoch ausreichend Zeit für die eigenständige Projektarbeit, das heißt ungefähr einen Arbeitstag pro Woche, einplanen. Aufgrund der geforderten Eigenständigkeit ist dieses Forschungsseminar vor allem für fortgeschrittene Studierende geeignet, die forschungsorientiert arbeiten und fachwissenschaftlichen Interessen folgen möchten.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul IX - Praxismodul (10 LP)
-- Keine Lehrveranstaltung in diesem Semester --
Modul X - Abschlussmodul (30 LP)
Examenskolloquium
Veranstaltungsnummer: 53504
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Axel Volmar
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Examens- und Forschungskolloquium für Verfasser*innen von Masterarbeiten, Dissertationen, Habilitationen und wissenschaftlichen Publikationen. Der Rahmen des Kolloquiums wird außerdem zur Einladung von Gastvorträgen genutzt.
Gebeten wird um vorherige Anmeldung an Axel Volmar:
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Medien, die wir meinen: Kolloquium zu Medienbegriffen aus medienarchäologischer, technomathematischer und epistemologischer Sicht
Veranstaltungsnummer: 53508
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Wolfgang Ernst
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Akademische Medienwissenschaft hat einen blinden Fleck der Selbstbeobachtung: den Begriff der "Medien" selbst. Unter Medien, die in der "Berliner Schule" gemeint sind, werden dezidierte techno-logische Konfigurationen verstanden. Im Kolloquium kommen verschiedene Verständnisse von Medien und ihre disziplinären Ausdifferenzierungen zur Sprache.
Primär dient das Kolloquium der Präsentation und Diskussion von Examensarbeiten, ferner Forschungsberichten aus dem Lehrgebiet Medientheorien, sowie externen Gastbeiträgen. Ein close reading widmet sich gelegentlich der kollektiven Lektüre vorgeschlagener Texte.
Die Bekanntmachung der wöchentlichen Themen erfolgt durch die Mailingliste
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Examenskolloquium Mediendramaturgie
Veranstaltungsnummer: 53517
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Dr. Florian Leitner
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Medienwissenschaft im Allgemeinen beschäftigt sich mit der wechselseitigen Abhängigkeit von Information und Medium, v.a. im Hinblick auf technische Medien. Aus dieser Perspektive nimmt auch die Mediendramaturgie, als Teilbereich der Medienwissenschaft, ihre Gegenstände in den Blick. Dabei fokussiert sie auf eine ganz bestimme Art von Medien-/Informationsprozessen — nämlich auf solche, die fiktionale Handlungen zum Inhalt haben.
In dem Kolloquium werden mediendramaturgische Theorien und Methoden besprochen, aktuelle Forschungspositionen vorgestellt und Examensarbeiten diskutiert.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Arbeits- und Examenskolloquium Digitalität, Materialität und Produktivität
Veranstaltungsnummer: 53522
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Examenskolloquium zur Vorbereitung und Begleitung von Masterarbeiten, Dissertationen und allem, was danach kommt und Arbeitskolloquium für fortgeschrittene Studierende.
Darüber hinaus dient das Kolloquium für die Diskussion von Forschungsberichten aus dem Lehrgebiet "digitale Medien" und der gemeinsamen kritischen Lektüre relevanter Texte ("Oberseminar").
Erbeten wird eine vorherige Bewerbung/Anmeldung per Email:
Anschließend erhalten Sie Informationen zum Raum, in dem das Kolloquium stattfindet.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Modul XI - Perspektiven der Medienwissenschaft (10 LP)
Medienwissenschaftliches Arbeiten für MA-Studierende
Veranstaltungsnummer:
Leistungspunkte:
Lehrende/r:
Marie-Luisa Glutsch
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Im Tutorium erarbeiten die Studierenden das Grundlagenwissen und die Basismethoden, auf denen das MA-Studium der Medienwissenschaft an unserem Institut aufbaut. Durch eine Aufarbeitung kanonischer Texte soll das Tutorium insbesondere der Orientierung in dem breiten Feld der Medientheorie dienen.
Die Teilnahme wird vor allem den MA-Studierenden dringend empfohlen, die ihr BA-Studium nicht am Fachgebiet Medienwissenschaft der HU absolviert haben.
Die erste Lehrveranstaltung am Montag, 15. April, findet für BA- und MA-Studierenden statt. Anschließend wird der Kurs im 14-tägigen Wechsel für BA- und MA-Studierende durchgeführt.
Es besteht die Möglichkeit, das Tutorium im ÜWP-Modul XI: Perspektiven der Medienwissenschaft anrechnen zu lassen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Einführung in die Grundlagen der Hörfunk-Arbeit; vom klassischen Radiobeitrag bis zu Podcast-Entwicklungen
Veranstaltungsnummer:
Leistungspunkte:
Lehrende/r:
Christine Watty
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Seminar /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Seminar vermittelt in drei Blöcken den theoretischen Hintergrund der Radioarbeit und dient als Vorbereitung für die praktische Mitarbeit beim Campusradio der HU couchFM.Was bedeutet Radio machen in der heutigen zeit? Das Seminar zeigt anhand vieler konkreter Hörbeispiele und gemeinsam mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der Praxis, wie der klassische Hörfunk heute funktioniert: Wie macht man eigentlich Radio? Welche journalistischen Fragen stellen sich heute für den Hörfunk inmitten der Nachrichtenströme aus dem Netz? Welchen Herausforderungen muss sich der moderne Hörfunk stellen, wenn es um die Digitalisierungsfragen geht? Wie haben sich Formate in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und welche Rollen spielen Wort und Musik in unterschiedlichen Sendungen? Wie kann man komplizierte Inhalte fürs Audio aufbereiten und welche Rolle spielt die Moderation?Das Seminar verfolgt die Grundlagen der Radioarbeit mit Blick auch auf den aktuellen Radiomarkt und seiner unterschiedlichen Ausrichtungen. Es geht um Themen, Aufbereitung, Zielgruppen und die passende Ansprache. Und schließlich um aktuelle Podcast-Entwicklungen und die Frage: Ist das schon Konkurrenz für das Radio oder noch Ergänzung des Audiomarkts?
Neben dem Besuch des "Grundlagenseminars" ist die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern möglich, sowie daran anschließend die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM jeweils montags ca. 18 - 21 Uhr.
Bitte melde Dich bei Interesse unter
Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Scheinerwerbs.
1. Nur der Besuch des Seminars (1 LP)
2. Besuch des Seminars und Sammeln von Radioerfahrung als Mitglied im Campusradio couchFM.
Dafür ist neben dem Seminarbesuch die Teilnahme an einem Workshop mit professionellen Radiomachern im Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) Pflicht sowie die Mitarbeit bei den Redaktionssitzungen von couchFM.
Termine der Workshops:
Einführung ins Hörfunkstudio:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 17.30 Uhr
Radio-Darstellungsformen:
Sonnabend, 4. Mai & Sonntag, 5. Mai, je 10.00 - 15.00 Uhr
Sprechen fürs Hören:
Sonnabend, 11. Mai & Sonntag, 12. Mai, je 10.00 - 17.00 Uhr
Audiorekorder und -schnitt:
Sonnabend, 15. Juni & Sonntag, 16. Juni, je 10.00 - 17.00 Uhr
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Tutorien
Medienwissenschaftliches Arbeiten für MA-Studierende
Veranstaltungsnummer: 53535
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Marie-Luisa Glutsch
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Im Tutorium erarbeiten die Studierenden das Grundlagenwissen und die Basismethoden, auf denen das MA-Studium der Medienwissenschaft an unserem Institut aufbaut. Durch eine Aufarbeitung kanonischer Texte soll das Tutorium insbesondere der Orientierung in dem breiten Feld der Medientheorie dienen.
Die Teilnahme wird vor allem den MA-Studierenden dringend empfohlen, die ihr BA-Studium nicht am Fachgebiet Medienwissenschaft der HU absolviert haben.
Die erste Lehrveranstaltung am Montag, 15. April, findet für BA- und MA-Studierenden statt. Anschließend wird der Kurs im 14-tägigen Wechsel für BA- und MA-Studierende durchgeführt.
Es besteht die Möglichkeit, das Tutorium im ÜWP-Modul XI: Perspektiven der Medienwissenschaft anrechnen zu lassen.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Grundlagen der Medienwissenschaft für BA-Studierende
Veranstaltungsnummer: Ü53534
Leistungspunkte: 3
Lehrende/r:
Marie-Luisa Glutsch
Sprache: Deutsch /
Veranstaltungstyp: Tutorium /
Veranstaltungsart: Präsenzveranstaltung
Das Tutorium dient der Einführung in die Grundlagen des medienwissenschaftlichen Arbeitens: Wie schreibe ich eigentlich eine Hausarbeit? Wie finde ich ein geeignetes Thema? Wie zitiere ich ordentlich? Im Verlauf des Tutoriums sollen Studierende Schritt für Schritt an das wissenschaftliche Schreiben herangeführt und bei der Ideenfindung für eine erste Hausarbeit begleitet werden. Außerdem soll den Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, im Tutorium alle Fragen zu stellen, die sich zu Studienbeginn ergeben.
Die erste Lehrveranstaltung am Dienstag, 17. Oktober, findet für BA- und MA-Studierenden statt. Anschließend wird der Kurs im 14-tägigen Wechsel für BA- und MA-Studierende stattfinden.
Weitere Informationen und/oder Anmeldung
Weitere Lehrveranstaltungen
-- Keine Lehrveranstaltung in diesem Semester --